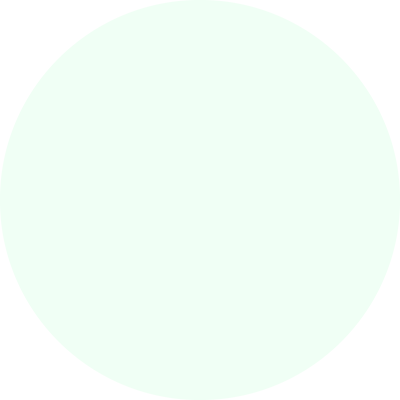Schwierige Zeiten erfordern besondere Lösungen
Während einer Wirtschaftskrise rücken Unternehmensinsolvenzen in den Fokus medialer Aufmerksamkeit. Auch die Politik reagiert auf die erhöhten Anforderungen an das österreichische Insolvenzrecht durch eine tiefgreifende Gesetzesreform. Vorrangiges Ziel des nunmehr vorliegenden Ministerialentwurfes ist (wieder einmal) die rechtzeitige Eröffnung von Insolvenzverfahren. Ebenso sollen die Sanierungschancen gesteigert werden. Die Mittel, mit denen dies erreicht werden soll, werden unter Experten derzeit kontrovers diskutiert. Im Kreuzfeuer der Kritik stehen insbesondere die Möglichkeit der Eigenverwaltung des Schuldners und die Beschneidung von Gläubigerrechten.
Eigenverwaltung und Rosinenpicken
Durch die Abschaffung der Ausgleichsordnung und die Übernahme der maßgeblichen Regelung in die Konkursordnung (künftig „Insolvenzordnung“) soll – wie auch in Deutschland – ein einheitliches Insolvenzverfahren geschaffen werden. Zentrales Element bildet darin die Eigenverwaltung. Der Schuldner führt sein Unternehmen weiter; ihm wird – wie auch im bisherigen Ausgleichsverfahren – ein Sanierungsverwalter als eine Art „Super-Aufsichtsrat“ zur Seite gestellt, der die Geschäftsführung überwacht. Zu diesem Zweck räumt das Gesetz dem Sanierungsverwalter auch ein Einspruchsrecht ein. Handlungen, die nicht zum gewöhnlichen Unternehmensbetrieb gehören, bedürfen jedenfalls der Genehmigung des Sanierungsverwalters. Für die Gläubiger bringt die Eigenverwaltung den Vorteil einer 10 % höheren Mindestquote (30 %).
Wie diese Möglichkeit zur Eigenverwaltung von der Praxis angenommen wird, bleibt abzuwarten. Der Schuldner hat, um überhaupt in den Genuss der Eigenverwaltung zu kommen, bei Verfahrensbeginn zu belegen, dass er zur Fortführung des Unternehmens und zur Erfüllung des Sanierungsplans mit der erhöhten Quote von 30% in der Lage ist. Kann (oder will) er das nicht, bleibt es beim bisherigen System des Zwangsausgleichs: Man wird zwar unter die Kuratel eines „Masseverwalters“ gestellt, andererseits aber durch ein niedrigeres Quotenerfordernis „belohnt“.
Die Versuchung liegt nahe, sich die Rosinen aus beiden Verfahrenstypen herauszupicken: Man legt zunächst bei Verfahrensbeginn einen ambitionierten Sanierungsplan vor, stellt eine mindestens 30%ige Quote in Aussicht (Stichwort: „Papier ist geduldig“) und bekommt so die Eigenverwaltung. Später – rechtzeitig vor der Abstimmung – wechselt man dann rechtzeitig ins „alte Verfahren“ zurück und entschuldet sich mit 20%. Die (bloß) kurze (ohnedies aufs „Formale“ beschränkte) Übergangsphase mit einem „Masseverwalter“ nimmt man in Kauf.
RichterInnen, die bei so einem „Rosinenpicken“ nicht „mitspielen“, werden den Sanierungsplan auf Plausibilität prüfen und ihn im Zweifel zurückweisen. Das könnte die Verfahrenseröffnung (zum Nachteil aller Beteiligten) regelmäßig verzögern und zu einem verstärkten Anwendung des § 73 KO (dann IO) führen, der – wie schon bisher – die „Einstweiligen Vorkehrungen“ für den Fall regelt, dass ein Verfahren nicht sogleich eröffnet werden kann. Nach dem Ministerialentwurf soll § 73 IO unverändert bleiben. Der Gesetzgeber wird gut beraten sein, die Bestimmung auf diese zu erwartenden Anforderungen anzupassen, etwa indem man dem „einstweiligen Verwalter“ oder einem sonst vom Gericht beigezogenen Fachkundigen die Möglichkeiten und Ressourcen an die Hand gibt, den Sanierungsplan rasch (binnen Wochenfrist) zu verplausibilisieren.
So gesehen fragt sich aber, ob es nicht überhaupt besser wäre, gleich „einheitlich“ ohne Eigenverwaltung zu starten und den Schuldner erst nach Prüfung des von ihm vorgelegten Sanierungskonzepts durch den Insolvenzverwalter binnen, sagen wir, längstens 14 Tagen in die Eigenverwaltung zu entlassen.
Zuckerbrot statt Peitsche
Die insolvenzrechtsbezogenen Normen wollen die allgemein gewünschte frühestmögliche Verfahrenseröffnung vor allem mit Strafen/Haftungen zu Lasten der Organe bzw. (über das Anfechtungsrecht) zu Lasten der (Banken-)Gläubiger erzwingen. Schon die bisherigen Novellen sind in diesem Punkt weitgehend erfolglos geblieben. Man sollte daher, wie etwa in den USA, mehr mit Zuckerbrot denn mit der Peitsche probieren:
Entscheidendes KO-Kriterium jeder gerichtlichen Sanierung stellt die Finanzierung der Unternehmensfortführung während des Verfahrens dar. Die Novelle – die sich ihrer Anlehnung an das amerikanische Chapter 11-Verfahren rühmt – bietet dazu leider nichts Neues. Zu erwägen wäre, die zum Zwecke der Fortführungsfinanzierung aufgenommene Kredite als „superprivilegierte“ Masseforderungen einzustufen. Gleichzeitig wäre klarzustellen, dass der Insolvenzverwalter befugt ist, die von ihm vorgefundene Sowieso-Masse mit Zustimmung der Gläubiger und des Gerichts zu Aufnahme eines Fortführungskredits zu belehnen (ohne in eine Haftungsfalle zu tappen).
Meines Erachtens müsste man sogar weiter gehen und die Kreditaufnahme durch eine vom Insolvenzgericht effektuierte erstrangige Belehnung bereits belasteter Vermögensgegenstände ermöglichen (sog. „Priming“ im US-amerikanischen Verfahren). Das wäre selbst für die betroffenen Gläubiger-Banken wesentlich besser (Erhaltung der going-concern-Werte, statt Zerschlagungswerte) als die nun vorgesehene (letztendlich ohnedies nicht effiziente) Abschwächung im Anfechtungsbereich. Ganz abgesehen davon käme es dadurch auch zu einer gerechteren Verteilung des „Sanierungsleides“. Die vorgesehene (durchaus zu begrüßende) Beschränkung der Vertragsauflösungstatbestände trifft nicht die Banken, sondern hauptsächlich die Lieferanten (die sich dagegen auch schon zur Wehr setzen).
Die berechtigte Aussicht mit Hilfe, wenngleich natürlich unter Kontrolle eines Insolvenzgerichts (samt einer Heerschar von Fachleuten) wieder zu (ausreichender!) Liquidität zu kommen, wäre für einen Schuldner ein wesentlich höherer Anreiz, frühestmöglich ein Insolvenzverfahren zu beantragen als die Bedrohung mit Haftungsfolgen (zumal, wenn der Betroffene durch Bürgschaftsübernahmen ohnedies schon längt in der Haftungsfalle sitzt.
Gastkommentar im Wirtschaftsblatt vom 8. Oktober 2009